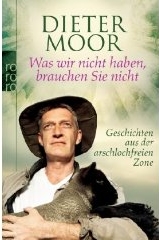Felix Philipp Ingold überließ mir den nachstehenden Aufsatz zum Abdruck im Lesebuch.
Der Aufsatz ist eine erweiterte Fassung des bei der NZZ veröffentlichten Artikels „Die bedeutungsfreie Dichtersprache.“
Felix Philipp Ingold zur Causa Oskar Pastior
Meinem vorgerückten Alter zum Trotz bin ich um einiges zu jung, um im Fall Schlesak vs. Pastior (NZZ 17.11.2010) als Zeitzeuge fungieren zu können. Ich habe Oskar Pastior erst lang nach seiner Übersiedelung in die BRD kennengelernt, bin ihm immer mal wieder bei Lesungen begegnet, habe ihn des öftern privat in Berlin besucht und führte mit ihm ausserdem während Jahren eine kollegiale Korrespondenz in der archaischen Form handschriftlicher Briefe. Ich darf annehmen, dass er mich – so wie ich ihn – als Freund bezeichnet hätte, wiewohl ich nie zu seinem innersten Bekanntenkreis gehörte. Nur vorübergehend intensivierte sich unser Kontakt, als wir für eine Weile gleichzeitig in Rom zugange waren und uns fast täglich in der Stadt oder in der Villa Massimo trafen. Danach blieb es wiederum bei zufälligen Begegnungen und lockerem Briefwechsel.
Was uns, nebst den gemeinsamen literarischen Interessen, besonders verband, war das aufmerksame Hinhören und Hinsehen auf die politischen Entwicklungen der 1980er Jahre in Osteuropa und der Sowjetunion. Ich war damals wiederholt in der CSSR, der DDR und Polen unterwegs, worüber ich auch Oskar Pastior berichtete, der mich – als Schweizer – geradezu bestaunte wegen der Leichtigkeit, mit der ich jene Grenzen überschritt, und auch wegen der kritischen Ironie, mit der ich auf die dort üblichen Zollschikanen und Kontrollmassnahmen reagierte: er selber würde „sterben vor Angst“ bei einem solchen Grenzübertritt, und sogar bei der Einreise nach Österreich überkomme ihn jedesmal ein „panischer Horror“. Mehrmals gestand mir Pastior, dass er noch immer befürchte, irgendwann wieder verhaftet und verschickt zu werden, und gelegentlich hatte ich den Eindruck, dass er die Liberalisierungstendenzen im sogenannten Ostblock eher mit Skepsis denn mit Euphorie zur Kenntnis nahm.
Dass dieser markante, unter Kollegen allseits beliebte Dichter nun in begründetem Verdacht steht, im kommunistischen Rumänien nicht nur ein Verfolgter, sondern auch ein Verfolger gewesen zu sein, macht sicherlich viele seiner Freunde nachdenklich, wenn nicht ratlos und ist auch für mich Anlass, an einige besonders einprägsame Momente zurückzudenken, sie im scharfen Licht der jüngsten Enthüllungen neu zu bewerten.
Erster Moment: ein Privatbesuch bei Oskar Pastior in seiner Wohnung an der Schlüterstrasse in Berlin. Wir reden über unsere aktuellen Beschäftigungen und Lektüren. Er berichtet von einem Besuch bei den „Oulipoten“ in Paris, von Begegnungen mit Jacques Roubaud und Harry Mathews, von seiner Entdeckung und Übersetzung des rumänischen Avantgardepoeten Urmuz, den ich eigentlich für eine von ihm, Pastior, erfundene Kunstfigur gehalten hatte. Beim Drehen einer Zigarette eröffnete er mir dann aber ziemlich überraschend, dass er „trotz allem“ besonders gern Schundliteratur lese und sich am liebsten B-Movies und TV-Krimis ansehe, „vor allem Krimis“, deren Faszinosum doch darin bestehe, dass wir dabei immer auch uns selbst – „da wir ja alle irgendwie kriminell sind“ – auf die Sprünge kommen.
Zweiter Moment: Ein Workshop mit Pastior in Goslar. Thema der Veranstaltung war „Das Wort“. Es gab Lesungen, Referate, Diskussionen. Als mir in Beantwortung einer Frage aus dem Publikum die etwas pathetische Formulierung unterlief, die Poesie habe „die Würde des einzelnen Worts gegenüber der Aussagekraft des Satzes“ zu festigen, unterbrach mich Pastior mit der dezidierten Zwischenbemerkung, eine „Würde des Worts“ gebe es für ihn nicht, er halte sich vielmehr an „das Würde des Worts“, denn alles Sprachliche sei „konditional und konjunktivisch“.
Dritter Moment: Die Feier zu Pastiors 60. Geburtstag (oder war’s der 65.?) in der Berliner Akademie der Künste. Zusammen mit mehreren Dichterkollegen sollte ich auf dem Podium vor grossem Publikum eine kleine lyrische Huldigung darbieten, und es war vorgesehen, dass der Jubilar am Schluss ein kurzes Dankeswort sprechen würde. Diese unaufwendige, eigentlich selbstverständliche Geste wurde für Oskar Pastior auf der Stelle zum Problem. Es komme für ihn nicht in Frage, an der Öffentlichkeit „frei zu reden“, sagte er, und er werde statt dessen ein paar Sätze aus seinem jüngst publizierten Buch auswählen, sie neu gruppieren und als Wortmontage vortragen. Ich sass rechts neben ihm am Tisch auf der Bühne, und er flüsterte mir zu: „Du weisst doch, dass ich Bedeutung hasse.“ Ich weiss, ich wusste auch damals, dass Pastior nach einer bedeutungsfreien Dichtersprache suchte, dass er keinen Bedeutungsraum hinter oder zwischen den Wörtern gelten lassen wollte. Gelten sollte das Wort als solches, das Wort als Klangleib ? nichts besagend, bloss leichthin an die Sinne rührend. Die im gedruckten Text unterstrichenen Verse rezitierte er dann so, als handelte es sich um eine lyrische Improvisation eigens zu jenem Anlass.
Naturgemäss stellt sich nun im Rückblick die Frage, ob nicht überhaupt Pastiors dichterische Arbeit, die man so gern als „hermetisch“, „formalistisch“ oder wenigstens als „ludistisch“ bezeichnet hat, darauf angelegt war, in kunstvoller Weise „nichtssagend“ zu sein, und ob sein konsequentes Bemühen, seine Texte von aller Bedeutung und vorab von jeder Eindeutigkeit freizuhalten, nicht auch andere denn poetologische Gründe hatte. Ausser Frage steht nun jedenfalls, dass die Pastior-Philologie noch einmal über die Bücher gehen und nach allfälligen Spuren verdrängter „Bedeutung“ suchen muss. Womöglich steht bei diesem „dunklen“ Dichter doch weit mehr zwischen den Zeilen, als er selbst es wahrhaben wollte und als die Kritik es bisher erkennen konnte.
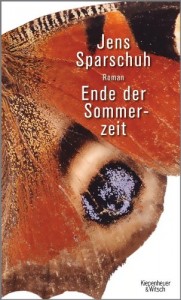 Jens Sparschuh ist mir als Autor bekannt, aus Feuilletons und Rezensionen. Ich habe sicherlich auch schon Einiges von ihm gelesen.
Jens Sparschuh ist mir als Autor bekannt, aus Feuilletons und Rezensionen. Ich habe sicherlich auch schon Einiges von ihm gelesen.  möchte man den Titel von Eugen Ruges Debut-Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ weiterspinnen.
möchte man den Titel von Eugen Ruges Debut-Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ weiterspinnen. Dieses Buch wurde interessant besprochen, wurde gelobt und herausgestrichen und nicht zuletzt wurde aus ihm bei der letzten Greifswalder Kulturnacht im Antiquariat Rose vorgelesen.
Dieses Buch wurde interessant besprochen, wurde gelobt und herausgestrichen und nicht zuletzt wurde aus ihm bei der letzten Greifswalder Kulturnacht im Antiquariat Rose vorgelesen.